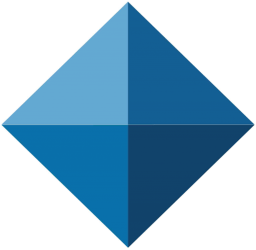Im Zuge einer heftigen Auseinandersetzung mit der Mutter droht ein 17 jähriges Mädchen dieser hochdramatisch mit Selbstmord. Die Mutter veranlasst einen psychiatrischen Aufenthalt. Im Zuge des Aufenthalts wird eine hystrionische Persönlichkeitsstörung festgestellt. Ein/e befreundete/r Bekannte/r interveniert im Spital und weist auf den stigmatisierenden Effekt dieser Diagnosen hin und bittet darum, die Diagnose fallenzulassen.
Im Selbstverständnis eines Spitals haben aber Diagnosen keine andere Bedeutung als die, Arbeitshypothesen aufzustellen und entlang dieser die „passende“ Behandlung/Therapie einzuleiten. Dank der großen Psychiatriereform Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts bleiben PatientInnen nicht mehr lange auf einer psychiatrischen Station, stattdessen werden sie an ein ambulantes Setting verwiesen. Oft gelingt eine solche Verweispraxis, nicht selten bleiben aber die Patientinnen und Patienten unversorgt „zurück“.
Dieses konkrete Mädchen hatte wenig Glück der anderen Art. Und, wie das Sprichwort so schön sagt, wer kein Glück hat, der hat dann bald auch Pech. In diesem Fall hat sich der Aufenthalt etwas hingezogen. Vielleicht war es ein Zusammentreffen ganz unterschiedlicher Systemsichtweisen: Eine gleichermaßen überzeugungsstarke wie besorgte Mutter, in Kombination mit dem von seinem Gefühlsausbruch überraschten Mädchen, einer psychiatrischen Station, die gerade mit ihrer Bettenauslastung zu kämpfen hatte und einer/m wohlmeinenden Stationssozialarbeiter/in. Letztere/r hat dann auch einen Handlungsbedarf gesehen. Sie hat dem Mädchen einen Behindertenstatus „organisiert“. Und jetzt ist sie gerade dabei, die mittlerweile 18 Jährige davon zu überzeugen, das Gymnasium aufzugeben und stattdessen eine Behindertenwerkstatt aufzusuchen. Man müsse es akzeptieren, meint die/der zuständige Sozialarbeiter/in, das Mädchen habe halt zu viele Defizite. Denn neben der diagnostizierten Persönlichkeitsstörung hat sich die Jugendliche mittlerweile auch noch eine Depression eingetreten.
Unterstützt wird die/der Sozialarbeiter/in – was für therapeutische Interventionsketten selten ist – von der Mutter und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten.
Schön, könnte man sagen, und „schön“ werden auch viele der Beteiligten sagen. Die Mutter wird froh sein, ihr Kind gut versorgt zu wissen. Um die im Streit erhobenen Vorwürfe der Tochter muss sie sich nicht (mehr) kümmern: Das arme Kind ist ja krank. Aus Sicht der Organisation kann man sich und dem Personal nur auf die Schultern klopfen: Endlich eine Fallbearbeitung nach Lehrbuch: statt kleinlicher professionsbedingter Streitereien und Eifersüchteleien eine berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit, eine funktionierende Interventionskette und – auch nicht schlecht – endlich eine im stationsübergreifenden Benchmarking eine herzeigbare Bettenauslastung. Die/der involvierte Sozialarbeiter/in kann sich auch freuen, hat sie für das Standing der Berufsgruppe in einem Spitalsbetrieb eine wichtige Hürde genommen: Ihr Vorschlag wird angenommen. Und nicht nur das: Wer weiß, vielleicht wird sie/er eines Tages als Pionier/in der „klinischen Sozialarbeit“ gefeiert. Und das Mädchen? Wie gesagt, Pech gehabt.
Hier interessiert mich vor allem die Haltung der involvierten Sozialarbeiterin / des involvierten Sozialarbeiters. Die Frage, die mich beschäftigt, lautet: ist die Intervention ethisch richtig?
Für einen Moment möchte ich bei der gestellten Diagnose bleiben: Die AutorInnen der ICD-10 und in deren Folge auch die Lehrbücher über Persönlichkeitsstörungen warnen davor, die Diagnose (vor)schnell zu stellen und weisen explizit darauf hin, die Diagnose solle keinesfalls vor dem 16., 17. Lebensjahr, im Zweifel solle lieber eine andere Diagnose gestellt werden (vgl. Drilling et.al. 1993; S227; Paulitsch, 2009, S 218 – 237), . Jetzt hatte die junge Frau ihr 17. Lebensjahr aber schon vollendet gehabt. Werden neuerdings Diagnosen nach einem ähnlichen Vorgehen gestellt, wie in der Juristerei, wenn über Fragen der Strafmündigkeit zu entscheiden ist: Unter 14 strafunmündig, älter als 14 bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres teilweise straffähig, ab 16 gibt es dann keinen (kaum einen) Pardon. Wie gesagt, das Mädel hatte Pech und ihren 17. Geburtstag hinter sich. Darüber hinaus gehören Diagnosen zum Spitalsbetrieb wie das Amen zum Gebet.
Psychiatrische Diagnosen erleben aber oft einen „Halo-Effekt“. Darunter versteht man, dass eine solche Diagnose schnell einmal an der Patientin / dem Patienten kleben bleibt. Von einer/m Spitalssozialarbeiter/in sollte man erwarten, dass sie/er darüber Bescheid weiß.
Nun zum berufsbedingten Verständnis der Profession „Sozialarbeiter/in“. Sozialarbeit, wie ich sie verstehe, orientiert sich an einer Reihe von Standards, die der Profession eingeschrieben sind. Für die Beurteilung der vorliegenden Frage scheinen folgende „Variablen“ interessant: Der von Bönisch/Lösch (1973; S 27-29) eingeführte Begriff des Doppelten Mandats , der von Staub-Bernasconi in der Folge zum Trippelmandat ausgebaut wurde. Während der erste Begriff meint, die soziale Arbeit sei sowohl den Zielen der Klientin / des Klienten als auch jenen des Staates, der die Soziale Arbeit bezahlt, verpflichtet, bringt letzterer Begriff noch die Dimension des professionellen Selbstverständnisses in den Diskurs mit ein.
- Doch zuerst zum Doppelten Mandat: Die zentrale Fragestellung, die sich aus dieser verschärften Arbeitsbedingung heraus ergibt, lautet: Wie kann die Profession, wie können die Handelnden in der Profession, sicherstellen, dass sie als „Diener zweier Herren“ ihre unter Umständen divergierenden Aufträge erfüllen? Zur Beantwortung dieser Frage sind eine Reihe weiterer Denkfiguren hilfreich:
- Die Soziale Arbeit kann man als „intermediäre Instanz“ verstehen, die zwischen System und Lebenswelt vermitteln soll (Rauschenbach/Treptow; 1985, S 55).
- Um diesen Vermittlungsauftrag zu erfüllen, wird eine allparteiliche Haltung (vgl. z.B. Kleve, 2003, S 67; zum Begriff selbst: Boszormenyi-Nagy, 1967: 412) verlangt,
- die sich im Zweifel parteilich für den Schwächeren äußern müsse.
- Ergänzt werden diese Überlegungen von Staub-Bernasconi zum „Dritten Mandat“ der Sozialen Arbeit. Dieses besteht, so die Autorin, aus zwei Komponenten. Zum einen habe sich die Profession auf die wissenschaftliche Fundierung ihrer Handlungstheorien zu berufen. Diese Forderung ergibt sich quasi zwangsläufig, wenn sich die Profession mit ihrem Anspruch ernst nehmen mag, mit ihren gesetzten Interventionen wolle sie die sozialen Probleme zumindest lindern. Diesen Anspruch müsse die Profession belegen können. Weiters impliziert die Forderung nach Wissenschaftlichkeit, dass Alltagserfahrungen, Intuition, Vorannahmen und Realitätskonstruktionen einer wissenschaftlichen Überprüfung standhalten sollen.
Zum Anderen fußt das Dritte Mandat auf einem Ethikkodex der Profession, der mit seinem „Bezug auf die Menschenwürde als Begründungsbasis“ die Abwertung der Hilfe an Individuen zugunsten struktureller oder fachpolitischer Arbeit verhindern soll (Staub-Bernasconi, o.J, S 7).
Legt man nun den aufgespannten Raster dem konkreten Handeln der sachbearbeitenden Kollegin / dem sachbearbeitendem Kollegen an, so ergeben sich daraus folgende Prüffragen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
- Nach welchen Kriterien und Entscheidungsmaximen hat die Kollegin / der Kollege ihr/sein Vorgehen gestaltet? Kann die Kollegin / der Kollege also sicherstellen, dass seine Schritte nicht nur nachvollziehbar und überprüfbar sind sondern darüber hinaus von anderen Kolleginnen/Kollegen ihrer/seiner Berufsgruppe nachvollzogen werden können (würden).
- Wie hat sie/er sichergestellt, das persönliche Vorannahmen, Wertungen, Haltungen nicht ihr/sein Handeln geleitet haben; dass also beispielsweise die Beurteilung, die Jugendliche habe „solche Defizite“, keine Auswirkung auf ihr Vorgehen gehabt haben? Oder anders herum: Seit wann spielen „Defizite“ in der Arbeit und im Denken von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern eine Rolle? In meinem Verständnis ist es Kernkompetenz der Profession eine zumindest „stellvertretende Inklusion“ der von Exklusion bedrohten Personen zu erreichen. Neu hingegen wäre mir, dass die Bemühungen um Integration dann bescheiden zurücktreten sollen, wenn sich Defizite zu „solchen Defiziten“ gesteigert haben. Weil klar: Bei so einem beeindruckendem Störungsbild einer histrionischen Persönlichkeitsstörung, die sich vor allem durch eine etwas theatralische Inszenierung der eigenen Persönlichkeit auszeichnet, noch dazu in Kombination mit einer Depression, muss die Profession resignierend zurücktreten und die Ärztinnen und Ärzte ihre Arbeit machen lassen, oder? Denn es ist so gar nicht vorstellbar, dass Jugendliche in der Hitze des Gefechts etwas die Kontrolle über sich und ihre Aussagen verlieren? Es ist auch komplett undenkbar, dass Eltern ihre intellektuelle Überlegenheit in der Auseinandersetzung mit ihren pubertierenden Kindern ausspielen und diese dann das Gefühl ohnmächtiger Demütigung erleben, aus dem heraus sie, die Kids, sich dann voll ehrlichem Hass von ihren Eltern abwenden oder ihnen – bei etwas anderer Sozialisation – den Suizid ankündigen? Komplett undenkbar muss es auch sein, dass eine institutionelle Behandlung bei einer in Entwicklung und Reifung befindlichen Persönlichkeit einen nachhaltigen und verängstigenden Eindruck hinterlässt, der sich unter Umständen in depressiver Symptomatik äußert? Ich verstehe: Nein, das kann nicht sein.
- Wie hat sie/er sichergestellt, dass die Jugendliche gehört und ihre Interessen bestmöglich vertreten wurde? (das Gebot der anwaltschaftlichen Parteilichkeit) Spannend wäre es doch zu erfahren, wie die Jugendliche selbst den Auslöser für ihre Psychiatrierung beschreibt. Welche Vorstellungen sie für die Stabilisierung das etwas zerrüttete Verhältnis zu ihrer Mutter entwickelt hat. Welche Vorstellungen hat die Mutter, was sie zu einem gelingenden Alltag mit ihrer Tochter beitragen kann? Was meint die Mutter, wie sie sicherstellen kann, dass sie ihren Fürsorgepflichten der Tochter gegenüber gerecht wird? In diesem Aushandlungsprozess könnte einer Sozialarbeiterin / einem Sozialarbeiter eine wichtige Aufgabe zukommen: Die Auseinandersetzung der beiden zu fördern und dabei peinlich genau darauf zu achten, dass die Spielregeln der Auseinandersetzung von beiden Seiten eingehalten werden. Weiters muss man an dieser Stelle fragen, welche konkreten Schritte die Kollegin / der Kollege unmittelbar nach Einlieferung der jungen Patientin gesetzt hat, um weiteren Schaden für sie, die Patientin, zu verhindern? Hat die Kollegin / der Kollege beispielsweise darauf geachtet, dass die Jugendliche die Untersuchung und die vorgeschlagene Behandlung nicht nur versteht sondern darüber hinaus ihre Sicht von den behandelnden / untersuchenden Ärztinnen und Ärzten zumindest gehört und in weiterer Folge adäquat darauf reagiert wurde? Hat die Kollegin / der Kollege peinlich genau darauf geachtet, dass die aufenthaltsbedingte Unterbrechung der Patientin in aller gebotener Kürze gehalten wird und die Jugendliche ehebaldigst wieder an ihrem Schultisch sitzen konnte? Oder abstrakter: Hat die Kollegin / der Kollege sichergestellt, dass die Jugendliche über die Folgen ihrer jeweiligen Entscheidungen bzw. der ihr widerfahrenden Behandlung ausreichend Bescheid wusste, so dass sie als handelndes Subjekt in diesem Prozess dessen Verlauf als – nahezu – gleichberechtigte Partnerin mitgestalten konnte?
- Wie hat sich die Kollegin / der Kollege abgesichert, statt der gebotenen Intermediarität nicht die „Sicht der Organisation“ zu übernehmen?
Literaturverzeichnis:
Bo?hnisch, Lothar/Lo?sch, Hans (1973): Das Handlungsversta?ndnis des Sozialarbeiters und seine institutionelle Determination, in: Otto, Hans-Uwe/Schneider, S. (Hg.): Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit, Bd. 2, Luchterhand, Neuwied/Berlin
Boszormenyi-Nagy, Ivan; From Family Therapy to a Psychology of Relationships: Fictions of the Individual and Fictions of the Family, in Comprehensive Psychiatry 7 (1966) nr. 5, 408-423.
Dilling H., Mombour, W.; Schmidt, M.H. (Hrsg), (1993): Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10, Kapitel V (F); klinisch-diagnostische Leitlinien / Weltgesundheitsorganisation; Verlag Hans Huber: Bern; Göttingen; Toronto; Seatle.
Kleve, Heiko, 2003: Sozialarbeitswissenschaft, Systemtheorie und Postmoderne. Grundlegungen und Anwendungen eines Theorie- und Methodenprogramms. Freiburg/Br.: Lambertus
Rauschenbach, Thomas /Treptow. Rainer, 1984: Sozialpa?dagogische Reflexivita?t und gesellschaftliche Rationalita?t, in: Mu?ller. S. u.a. (Hg.), Handlungskompetenz In der Sozialarbeit/Sozial- pa?dagogik. 11. Bleiefeld. S. 21-71
Pantucek, Peter /1998): Lebensweltorientierte Individualhilfe. Eine Einführung für Soziale Berufe. Lambertus-Verlag, Freiburg.
Paulitsch, Klaus (2009): Grundlagen der ICD-10-Diagnostik; Facultas Verlag: Wien
Staub-Bernasconi, o.J., Vom beruflichen Doppel- zum professionellen Tripelmandat. Wissenschaft und Menschenrechte als Begründungsbasis der Profession Soziale Arbeit. http://www.avenirsocial.ch/cm_data/Vom_Doppel-_zum_Tripelmandat.pdf, abgerufen am 10.08.2010