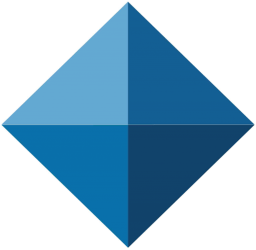nachfolgender Artikel ist das erste Mal 2004 im „Lesebuch Sucht und Geschlecht“, erschienen (Verein Dialog, 2004, S 49ff; Wien) und wird hier zur Illustration meiner Grundhaltung nochmals „publiziert“:
Wenn ich meine Arbeit jemandem auf ganz einfache Art und Weise erklären möchte, so sage ich, Psychotherapie beschäftigt sich mit der Heilung von seelischen Leidenszuständen. Die wichtigsten Instrumente dafür sind „Wahrnehmung“ und „Deutung“. Die Wahrnehmung erfolgt über verbale und nonverbale Kanäle. Die Deutung stellt meine Wahrnehmung dem Gegenüber wieder zur Verfügung. Über die Auseinandersetzung zwischen meiner Wahrnehmung von dem „Problem“ oder „Leiden“ und dem beschriebenen „Problem“ oder „Leiden“ ergibt sich – neben der Auseinandersetzung um die Sache – eine Auseinandersetzung um die „Beziehung“ zwischen mir und meinem Gegenüber. Als Psychotherapeut ist mir die Auseinandersetzung um die Beziehung das eigentlich Wichtige, wohin- gegen die Auseinandersetzung um das „Leiden“ oder „Problem“ bloß zum Medium der Wahl wird: Die Arbeit an den biografischen Details erleichtert – ähnlich wie die Traumarbeit – die Annäherung an das Verständnis des psychischen Apparats.
In meiner Ausbildung habe ich sieben oder mehr Jahre gelernt, auf mein Gegenüber einzugehen. Dabei wurde ich angehalten, der Wahrnehmung der Beziehungsaspekte hohe Priorität einzuräumen. In den Protokollen zu den Gruppensitzungen sollten wir nicht nur den manifesten Themen und ihrer Bearbeitung Raum geben, sondern mehr noch den Beziehungsgestaltungen: Wer hat auf wen wann warum reagiert?; welche gruppendynamischen Inhalte wurden über die vordergründigen Themen noch abgehandelt?, wie haben die Geschlechter aufeinander Bezug genommen?, welche Spannungen konnten aufgelöst, welche nur angesprochen, welche konnten nicht mal angesprochen, sondern von uns nur vermutet werden usw. Sexualität war immer im Raum, meine Zugehörigkeit zu einem Geschlecht auch, ebenso mein Rollenverständnis davon, aber auch meine Geschlechtlichkeit, selbstverständlich auch die Inszenierungen der Geschlechter und Geschlechterrollen. Die Protokolle wurden von den AusbildungsleiterInnen auch und vielleicht vor allem dahingehend überprüft, ob und inwieweit wir in der Lage waren, das komplexe Gruppengeschehen abseits der vordergründigen Inhalte zu erfassen. Einigen AusbildungskollegInnen wurde das Weiterkommen versagt bzw. es wurde ihnen eine Reihe von Auflagen mit auf den Weg gegeben, etwa, sie mögen bitte noch ein bis drei Jahre in einer Männer- oder Frauengruppe verbringen und sich mit ihrer Geschlechterrolle auseinander setzen…
Ich kann mich noch gut an die Zusatzseminare erinnern: „Animus und Anima“; „Geschlechterkampf im Büro“; „Sexualität in der Traumarbeit“; „Die Rolle des Therapeuten im Diagnoseverfahren“; „Über Prinzen und Prinzessinnen“; „weibliche und männliche Rollenentwicklung“ usw. Wir wurden hingeführt auf die eigene Auseinandersetzung mit „mir und dem Fremden in mir“, meiner „angenommenen Geschlechterrolle“ und der daraus resultierenden „erwarteten Rollenkonserve“. In jedem Seminar wurden wir darauf hingewiesen, dass – egal wie gut wir die vermittelten Techniken auch anwenden werden können – wir in unserer täglichen Arbeit doch immer nur auf unseren eigenen Schatz an Erfahrungen zurückgreifen werden können; das Fremde würde uns fremd bleiben und wir könnten uns dieser Fremdheit bestenfalls mit großer Vorsicht, Neugierde und vor allem Demut nähern.
Heute, nach mehr als 10 Jahren „Felderfahrung“ möchte ich sagen, dass ich gute Arbeit leisten kann bei „meinesgleichen“: Männern meiner Altersgruppe plus/minus 15 Jahre, mit einer proletarischen oder lumpenproletarischen, großstädtischen Sozialisation, wenn es sein muss aus Mitteleuropa, besser aber aus meinem Sprachraum, wenn das Wiener sind, so wie ich, hab ich ein „Heimspiel“. Treten mir Menschen aus „fremden Kulturen“ gegenüber, versagt meine „Gegenübertragung“: Meine Arbeit wird langsamer, ist fehleranfälliger, ich bin gezwungen, mein Gegenüber öfter um Erklärungen zu bitten.
Ähnliches gilt für meine Arbeit als heterosexueller Mann mit heterosexuellen Frauen: „Sex is in the air“; mich irritieren ihre Schuhe, der glitzernde Ring, die Beine, ihr Busen, die geschminkten Lippen, der Augenaufschlag, das Zittern der Lippen, wenn es gerade ein bisschen „dicht“ geworden ist, das Parfum usw. In meinem Kopf laufen dann Begegnungen mit Frauen durch, in denen ich ähnliche Situationen, aber in anderen Rollen erlebt habe: als Tarzan, als Softie, als Possenreißer, als Eroberer, als Bewunderer, als ein zum Frosch verzauberter Prinz, als Adam, als „fauler Willie“, als enttäuschter Liebhaber, als Sohn, als Bruder usw. Bloß: die Situationen taugen nicht, hier sitze ich in einer anderen Rolle: Vielleicht wird hier Mütterlichkeit erwartet oder eine alte Weise, die „gute Fee“, die bissige Großmutter, die gewährende/versagende Mutter, die Lieblings-Schwester, die abgetriebene Tochter, das Wunschkind, die „böse Stiefschwester“ usw. Hand aufs Herz: die alte Weise nimmt mir niemand ab, selbst wohlmeinende KollegInnen nicht…
Meine „Spezialität“, mit Verweisen auf „Alltagsgeschichten“ aus bekannten Filmen, Büchern, Liedertexten den vordergründigen Inhalt mit dem wahrgenommenen Bedeutungszusammenhang einerseits sichtbar zu machen und andererseits in einen größeren gesellschaftlichen Rahmen überzuführen, funktioniert nur vor dem Hintergrund einer ähnlichen schicht- und geschlechterrollenspezifischen Sozialisation. Das Zitieren eines Liedertextes von Kurt Ostbahn führt bei heterosexuellen Männern in aller Regel zu einem spontanen „Verstehen“ oder „Mitgehen-Können“, wohingegen heterosexuelle Frauen gewöhnlich einen Beipacktext dazu erwarten. Selbst Verweise auf Geschichten aus der Bibel funktionieren erstens nur vor dem Hintergrund der Sozialisation in einem christlich-jüdischem Kulturkreis – bei Muslimen löse ich damit keine Assoziationen aus – und zweitens bei Männern eher als bei Frauen: Während die Beziehung zwischen Vater und Sohn aus nahezu jedem beliebigen Absatz heraus leuchtet und für den männlichen Erfahrungshintergrund leicht aufbereitet werden kann bzw. spontan verständlich ist, sind geeignete Stellen für weibliche Sozialisationserfahrungen für mich nur spärlich auffindbar.
In der Suchtarbeit treffen wir – verglichen mit der durchschnittlichen Klientel psychotherapeutischer Praxen – häufig auf Personen mit einer diagnostizierbaren Persönlichkeitsstörung. Erklärungsmuster für Persönlichkeitsstörungen verweisen auf „frühe Störungen“, also auf frühkindliche Mangelerfahrungen etwa in den Bereichen der unmittelbaren Sicherheit und Geborgenheit, der erleb- und spürbaren Kontinuität, des sich immer wieder bestätigenden Vertrauens, das schlussendlich die gemachten Erfahrungen zu Erfahrungs- und Verhaltensbündel „clustert“. Uns sitzen Personen gegenüber, deren „harte Schale“ uns – schon lange nicht mehr – hinwegtäuscht vor deren weichen, diffusen, amorphen „Kern (-Selbst)“. Sie sind erkennbar in ihrer Unsicherheit, in ihrem Festhalten an Verhaltens- und Rollenstereotypien, in ihrer „Als-ob-Persönlichkeit“. Sie rühren mich selbst heute noch in ihrer kindlichen Suchbewegung, in ihren Gefühlsausbrüchen, ihrem blinden Zorn, ihrer großen Verzweiflung, ihrer Apathie, ihrem Feststecken in einem Körper der eine Entwicklung durchgemacht hat, welche die Persönlichkeit noch vor sich hat.
Was diesen Personen zu wünschen ist, ist eine „gute Mutter“ oder ein „guter Vater“, eine Identifikationsfigur für die eigene Geschlechterrolle, eine Einladung zu einer gemeinsamen Zeitreise in die Zukunft, in der die wichtigste Verbündete die geschlechterrollenbewusste TherapeutIn ist, die in – den gewiss kommenden – Zeiten der Rückschläge und Krisen als Identität stiftendes Role-Model zur Verfügung steht. Sie brauchen jemanden, der sie „spontan“ versteht, ohne „viele Worte“, der das Vakuum der Geschlechterrollen-Entwicklung und die diffuse Unsicherheit daraus unmittelbar verstehen und darauf reagieren kann. Sie brauchen ganz sicher keine falschen Mütter oder falschen Väter, von denen hatten sie in ihrer Biografie bis zum Abwinken genug.