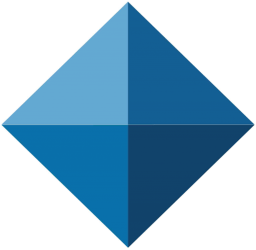Über (psycho-)therapeutisches Tischtennisspielen und andere Formen (psycho-)therapeutischer Freizeitgestaltung
Unlängst hatte ich die Ehre in einer sozialpädagogischen Einrichtung einem denkwürdigen Dialog beizuwohnen:
Sozialpädagoge zum Psychotherapeuten: Sag, wenn ich mit den Kids Tischtennis spiele, sagst du, ich mach es mir leicht. Und vielleicht sagst du damit auch, ich sollte endlich zu arbeiten beginnen. Kannst du mir bitte erklären, warum du dann manches mal zwei Stunden am Stück mit dem Max Tischtennis spielst und offensichtlich Spaß hast?
Psychotherapeut zum Sozialpädagogen: Wenn ich dir beim Tischtennisspielen zuschaue, dann sehe ich ja, dass du das aus reinem Vergnügen machst. Ich hingegen arbeite. Das Tischtennisspielen mit dem Max ist harte psychotherapeutische Arbeit. Ich muss ja mit dem in Kontakt kommen. Und das mit dem Lachen und der ‚offensichtlichen Freud‘‘ ist nichts anderes als mein professionelles Bemühen die Kontaktanbahnung zu erleichtern.
Sozialpädagoge: ‘tschuldigung, wir reden über den Max, der ist schon seit 2 Jahren im Haus. Liegt es nicht eher daran, dass er der beste Tischtennisspieler unter den Jugendlichen ist?
Psychotherapeut: Wenn du so misstrauisch bist, dann kann ich meine therapeutische Wirkkraft ja gar nicht entfalten! (…)
Ich hatte bei dieser Gelegenheit nicht den Auftrag, zu einer Klärung beizutragen oder gar zu einer Präzisierung eines therapeutischen Konzepts. Beschäftigt hat mich diese Episode allemal. Immerhin hatte ich – wahrscheinlich berufsbedingt – einen Solidarisierungsimpuls mit dem Berufskollegen: Wie kann jemand Berufsfremder das therapeutische Vorgehen infrage stellen?
Die Antwort darauf fällt mir mittlerweile leicht: Psychotherapie, wie jeder andere qualifizierte Beruf im weiten Feld von Beratung und Heilung, unterscheidet sich von unqualifizierten Beratungs- und Heilungsangeboten dadurch, dass eine jede Intervention zu jeder Zeit erklärt werden kann und vom Gegenüber als gewünscht angenommen wird und – im günstigen Fall – im Rückblick als hilfreich bewertet wurde. Nur weil ein Psychotherapeut mit einem Klienten Tischtennis spielt, ist das noch lange kein Heilverfahren. Es wird selbst dann nicht Psychotherapie, wenn es zur ‚Kontaktanbahnung‘ – also der Vorbereitung einer möglichen Therapie – genutzt wird. Wenn der Kollege tatsächlich seit zwei Jahren versucht, Kontakt mit dem Max zu bekommen, wäre ihm vielleicht eine gute Supervision oder Weiterbildung zu empfehlen; vielleicht auch ein Wechsel des Arbeitsplatzes.
Wer für die Supervision eintritt, der könnte das beispielsweise mit der Fürsorgepflicht des Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeiter_innen argumentieren: Das Unternehmen hat einen vertraglich festgelegten Auftrag zu erfüllen (im Sinne eines bestmöglichen ‚Upbringings‘ der anvertrauten Jugendlichen). Dafür hat es qualifizierte Mitarbeiter_innen zu beschäftigen. Und wenn die Mitarbeiter_innen ‚schwächeln‘, dann wäre es eben die unternehmerische Pflicht der juristischen oder/und inhaltlichen Leitungsperson, diese Mitarbeiter_in zu unterstützen.
Wer für ‚Weiterbildung‘ eintritt, der hat eher ein Konzept der ‚geteilten Verantwortung‘ im Kopf. In diesem Fall werden die ‚zwei Jahre‘ des Kontaktanbahnungsversuchs als professionelle Schwäche des Kollegen gedeutet, die ‚so gravierend‘ ist, dass eine einfache Beratungsleistung nicht ausreicht, während sich gleichzeitig das Unternehmen bemüht ein guter Arbeitgeber/eine gute Arbeitgeberin zu sein. In diesem Fall wird man möglicherweise um die Verteilung von Dienstfreistellungen und Urlaubstagen sowie um die Verteilung der Weiterbildungskosten verhandeln müssen.
Wer sich aber für den Arbeitsplatzwechsel des Kollegen einsetzt, der wird wahrscheinlich vor allem die Kosten für die öffentliche Hand vor Augen haben und sich möglicherweise von einer Art ‚gerechtem Zorn‘ getragen fühlen, über all die Abermillionen von Euros die scheinbar gedankenlos – jedenfalls ohne Qualitätssicherungsmaßnahmen – in das bestehende Sozial- und Gesundheitssystem fließen. (Wissend, dass man mit der Kündigung des Kollegen ‚den Sack und nicht den Esel‘ schlägt).
In meiner Beobachtung von Organisationen – vor allem im Sozialsystem – hat eine solche Argumentation von Kolleg_innen allerdings überhaupt keine Konsequenz. Es wird von allen Beteiligten so getan, als wäre diese Haltung selbstverständlich und in Ordnung. Mag sein, dass sich die Kollegen dann augenzwinkernd auf einen für alle Mitarbeiter_innen vornehmlich angenehmen ‚modus operandi‘ einigen; nach dem Motto: ‚Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus‘. ‚Vornehmlich angenehm‘ nenne ich dieses Vorgehen deshalb, weil es die Mitarbeiter_innen befreit vor einer Auseinandersetzung unter Peers (‚um was eigentlich?‘), die Vorgesetzen befreit es von einer Auseinandersetzung um das ‚fachlich richtige‘ Vorgehen und die Unternehmensleitung braucht sich die Frage nach dem effektiven Mitteleinsatz nicht zu stellen. Leider hat ein solches Verhalten aber allerorten beobachtbare Auswirkungen: Immer mehr Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen werden von ihren Geldgeber_innen ‚entmündigt‘; sie bekommen Verträge diktiert und müssen dazuschauen, wie sie diese umsetzen können (besonders deutlich jetzt in der Steiermark zu beobachten, wo über das Behinderteneingliederungsgesetz nahezu alle Maßnahmen des Sozialwesens gefördert werden; unter zum Teil absurden Rahmenbedingungen). Und selbstverständlich folgen die Verträge der Logik der Politik, die selten fachkundig ist, dafür immer (und verlässlich) nach den nächsten Wahlen schielt. Dann macht es einfach(en) Sinn nachweisen zu können, man habe soundso viele Plätze in dem und dem Angebotsfeld geschaffen. Denn nach den Ergebnissen dieser Angebote fragt vordergründig niemand. Nachrangig aber all jene, die von diesen Angeboten ‚betroffen‘ sind und sich schlicht unwürdig oder/und schlecht behandelt gefühlt haben (wie seit fast zwei Jahren die Diskussion im Arbeitslosenbereich zeigt und ganz generell im Wahlverhalten zum Ausdruck kommt [bloß weist niemand auf den Zusammenhang zwischen billiger Kumpanei unter Kolleg_innen, fachlichem Laissez-faire, schlechten Verträgen für Einrichtungen und Demokratiemüdigkeit hin]).
Manches Mal frage ich mich, wie wohl eine Welt ausschauen würde, in der sich Organisationen (z.B. im Sozialbereich) die Frage stellen würden: ‚Was kann unser Beitrag dafür sein, dass die Mittel der öffentlichen Hand bestmöglich und nachhaltig eingesetzt werden?‘ Wie würde sie sich als Organisation im öffentlichen Diskurs präsentieren: als Expert_innen-Organisation?; als ‚gute Nachbarn (frei nach Peter Drucker)?; als ‚Mittler zwischen den Welten‘ (zwischen der Welt der Hilfesuchenden, der sogenannten Öffentlichkeit sowie der Politik und der ihr nachgelagerten Verwaltung)?, eher laut oder eher leise? Nach welchen Kriterien würden Entscheidungen getroffen werden (neben solchen der Wirtschaftlichkeit; eventuell das Gemeinwohl im Blick oder doch eher den Shareholder-Value)? Für welchen Umgang mit ihren Führungskräften würde sie sich dann entscheiden? Welchen Umgang mit Mitarbeiter_innen würde sie von ihren Führungskräften verlangen? Würde sie überhaupt etwas ‚verlangen‘? Was wären Kriterien für einen effektiven Mitteleinsatz? Warum gerade diese Mittel? Und wie schaut es mit Learning-Loops aus? … Ach: und wie wohl würde eine solche Organisation mit den beiden Kolleg_innen verfahren?